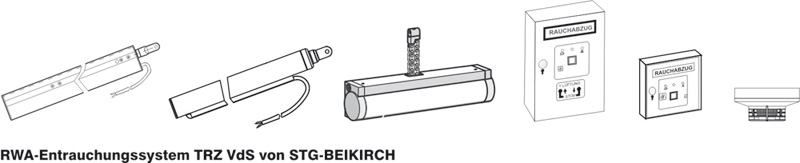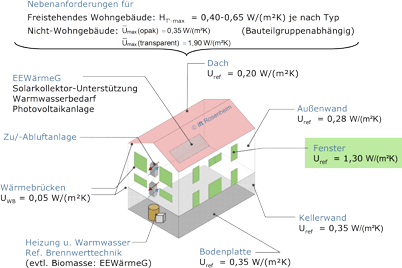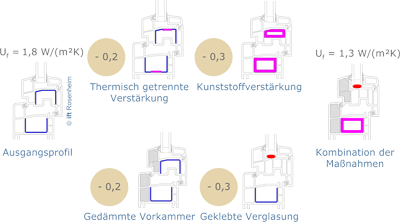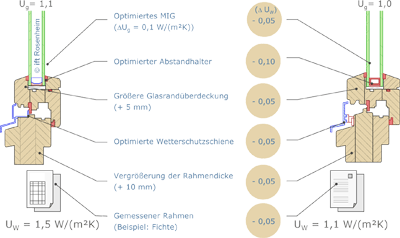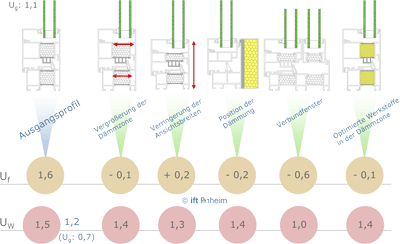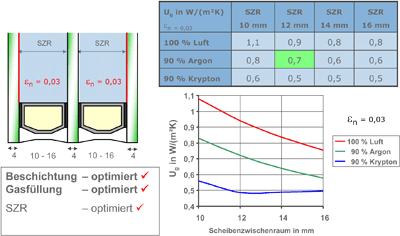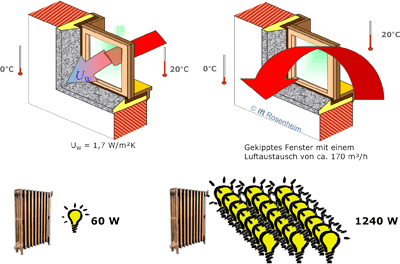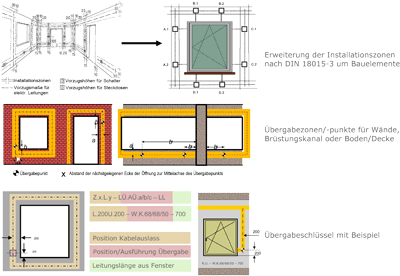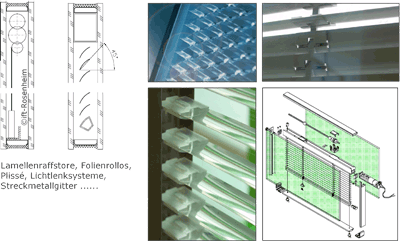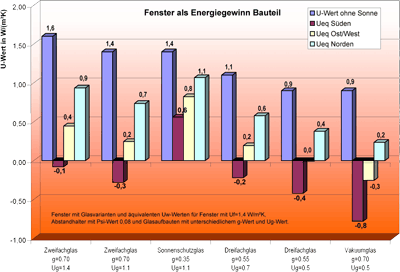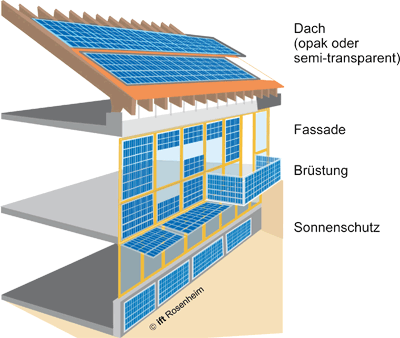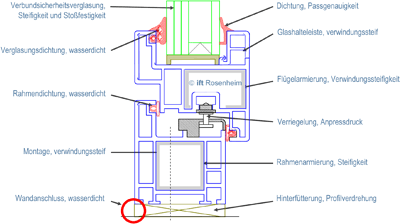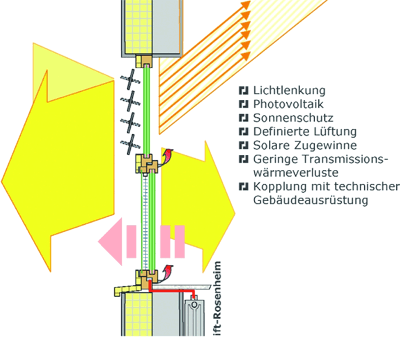Fachbeitrag von Jürgen Benitz-Wildenburg, ift Rosenheim
Der aktuelle CO2-Gebäudereport des Bauministeriums (BMVBS) zeigt, dass der Gebäudebereich mit ca. 17,3 Mio. Wohngebäuden, 39 Mio. Wohneinheiten und 1,5 Mio. Nichtwohngebäuden ca. 40% der CO2-Emmissionen verursacht. Es geht darum, den Gebäudebestand mit technischen Innovationen energieeffizienter zu machen und auf erneuerbare Energien auszurichten. Nach Untersuchungen der Deutschen Energieagentur (dena) lässt sich der Energieverbrauch von Häusern im Bestand um bis zu 85% reduzieren. Allein durch den Austausch von energetisch veralteten Fenstern und Verglasungen ließen sich in Deutschland pro Jahr bis zu 8,6 Mrd. Liter Heizöl sparen („Studie zur energetischen Modernisierung alter Fenster“, Branchenverbände VFF und BF 12/2007). Die Mindestanforderungen an die U-Werte werden deshalb in der neuen EnEV, die ab Oktober 2009 in Kraft tritt, auch deutlich verschärft. Bei einer baulichen Sanierung werden die Anforderungen an den U-Wert von Fenstern von 1,7 auf 1,30 W/(m²K) verringert. Mit den neuen europäischen Produktnormen für Fenster, Fassaden und Glas wird zudem für Planer, Hersteller und Nutzer eine funktionsorientierte und materialneutrale Ausschreibung einfacher (siehe auch ift-Ausschreibungshilfe). Fazit: innovative Produkte sind gefragt.
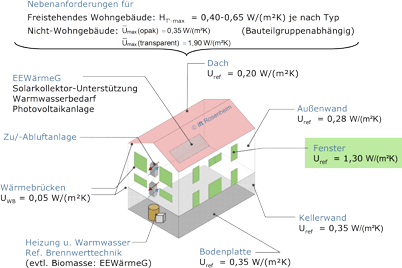
Bild 1 – U-Werte für Referenzgebäude im Nachweisverfahren der EnEV 2009 (Bild vergrößern)
Innovative Fenster- und Fassadenkonstruktionen
Um die Energieeffizienz von Fenstern und Fassaden zu verbessern, müssen die Wärmedämmung, die Lüftung, die Tageslichtnutzung und der sommerliche Wärmeschutz optimiert sowie die Solarenergie intensiver genutzt werden. Innovative Fenster- und Fassadenkonstruktionen nutzen deshalb folgende Technologien:
- Optimierung der Profilgeometrie (Kammeranzahl, verbesserte Wärmedämmzonen etc.) und Verbesserung der Konstruktion (Dichtungsebenen, Glaseinstand, Kastenfenster),
- Reduzierung der Profilbreiten (höherer Glasanteil),
- Verbesserte Baukörperanschlüsse (Überdeckung der Blendrahmen),
- Entwicklung neuer Glaseinbindungen und wärmetechnisch verbesserte Randverbundsysteme,
- Neue Materialien und Beschichtungen mit geringerer Wärmeleitfähigkeit und Emissivität,
- Einsatz vakuumgedämmter Paneele (Vakuumisolationspaneele VIP) mit besserer Dämmwirkung (Wärmeleitfähigkeit von 0,004 W/(mK)),
- Vermeidung von Lüftungswärmeverlusten durch höhere Dichtigkeit bei gleichzeitiger Sicherstellung der notwendigen Mindestlüftung für die Wohnraumhygiene,
- Verbundfenster und Zweite-Haut-Fassaden mit Nutzung des Zwischenraums für Sonnenschutzsysteme, Lichtlenkung, Lüftungseinrichtungen, Energiegewinnungssysteme,
- Reduzierung von Kunstlichteinsatz mittels besserer Tageslichtnutzung,
- Anbindung der Gebäudehülle an die Haustechnik,
- Einsatz von Solar-/Photothermie und Photovoltaik.
Optimierung von Kunststoff-Fenstern, Holzfenstern und Metallfenstern
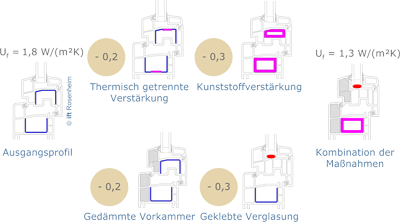
Bild 2 – Optimierung von Kunststoff-Fenstern (Bild vergrößern)
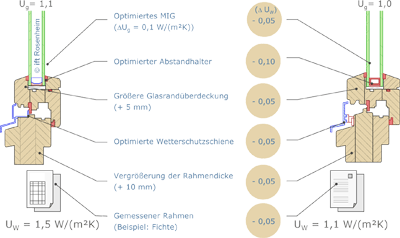
Bild 3 – Optimierung von Holzfenstern (Bild vergrößern)
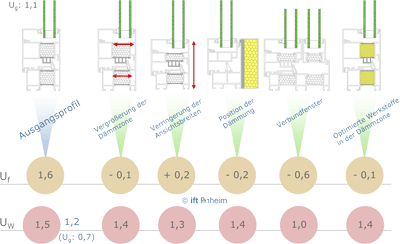
Bild 4 – Optimierung von Metallfenstern (Bild vergrößern)
Optimierung der Verglasung
Wärmetechnische Innovationen bieten auch die Glashersteller. Das Dreifach-Isolierglas ermöglicht schon heute eine deutliche Reduzierung der Wärmeverluste mit Ug-Werten bis zu 0,5 W/(m²K), die mit hochwertigen Edelgasen wie Krypton oder Xenon möglich sind. Wirtschaftlich sinnvoll ist aber die Füllung mit Argongas mit einem Ug-Wert von 0,7 W/(m²K). Verbesserungen bringen auch wärmetechnisch optimierte Randverbünde und ein tieferer Glaseinstand. Der UW-Wert des Fensters kann bei einem Glaseinstand von 25 mm um bis zu U = 0,05 W/(m²K) verbessert werden – positiver „Nebeneffekt“ ist die Erhöhung der Oberflächentemperatur im Glasrandbereich mit vermindertem Tauwasseranfall bei geringen Außentemperaturen. In der Entwicklungsphase sind derzeit noch Vakuumverglasungen. Sie erreichen bisher „nur“ Ug-Werte von 0,8 bis 1,0 W/(m²K), in einigen Jahren werden Werte von 0,5 W/(m²K) erwartet. Vorteilhaft sind ein geringes Gewicht und eine Baudicke von 8 bis 10 mm. Die Vakuumverglasung kann so als Ersatz für Einfachverglasungen dienen, z.B. bei denkmalgeschützten Gebäuden. Ein Einsatz in Zweifach- oder Dreifachverglasungen ermöglicht weitere Optimierungen (Zwei kleine Querverweis: „Vakuumisolierverglasung: Neue Aussichten für Fenster“ vom 18.4.2008 und „Untersuchung zum thermischen Komfort von Dreifach-Isoliergläsern“ vom 15.5.2008).
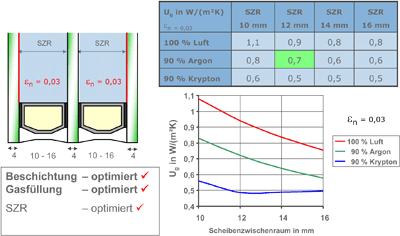
Bild 5 – Technische Daten von Dreifachglas (Bild vergrößern)
Fensterlüftung
Bei kontinuierlicher Senkung der Transmissionswärmeverluste wird der Anteil der Lüftungswärmeverluste immer größer – vor allem, wenn keine Wärmerückgewinnung stattfindet. Eine kontrollierte und geplante Lüftung wird immer wichtiger, weil neue Baukonstruktionen zudem wesentlich luftdichter geworden sind, sich aber die Lüftungsgewohnheiten der Gebäudenutzer nur selten der neuen Situation anpassen. Das gewohnte Lüftungsverhalten führt nach Gebäudesanierungen deshalb oft zu erhöhten Feuchtebelastungen im Innenraum und zur Bildung von Schimmelpilz. Grundsätzlich muss entschieden werden, ob eine zentrale oder eine dezentrale Lüftung für die jeweilige Bauaufgabe besser geeignet ist. Untersuchungen zeigen, dass die Anpassung des Gebäudekonzepts an eine dezentrale Lüftungstechnik zu einer großen Nutzerakzeptanz und Flächeneffizienz führt. Zur Bewertung von innovativen dezentralen Fensterlüftern hat das ift Rosenheim die ift-Richtlinie „LU-01/1 Fensterlüfter“ (siehe auch Beitrag vom 9.8.2007) erarbeitet, in der sich viele praktische Hinweise zur Bewertung und Planung finden.
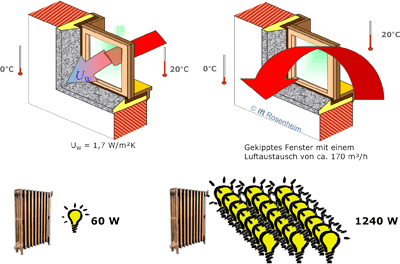
Bild 6 – Großes Einsparpotenzial durch moderne Fensterlüftung (Bild vergrößern)
Mechatronik bringt Komfort
Der Einsatz von elektronischen und elektromechanischen Bauteilen ist eine Schlüsseltechnologie für die Fenster-, Türen- und Fassadenbranche, denn damit lassen sich die steigenden Anforderungen an Energieeffizienz, Nutzerkomfort, Sicherheit und Barrierefreiheit optimal erfüllen. In modernen Bürogebäuden können intelligente Fenster und Fassaden den Einsatz von Klimaanlagen und künstlichem Licht reduzieren und gleichzeitig das Wohlbefinden der Nutzer erhöhen. Die Integration gebäudetechnischer Anlagen (Sonnenschutzsysteme, Lüftungsgeräte, Beleuchtung) in die Fassade bringt Vorteile. Sensoren messen Einflussgrößen wie Luftqualität, Lichtstärke, Luftfeuchte und Raumtemperatur und lösen automatisch bedarfsorientierte Reaktionen aus. Bei der Verwendung elektronischer Bauelemente und deren Anbindung an die Gebäudetechnik gibt es aber derzeit noch etliche Probleme, beispielsweise wenige Regelwerke und Vorgaben, die Angaben zu Anordnung und Ausführung der elektrischen Leitungen machen. Auch die Schnittstelle zu anderen Baugewerken ist unzureichend definiert und erschwert Planung und Einsatz. Deshalb hat das ift Rosenheim die ift-Richtlinie EL-01/1 „Elektronik in Fenstern, Türen und Fassaden“ erarbeitet, in der sich viele praktische Hinweise zur richtigen Planung und Ausführung finden.
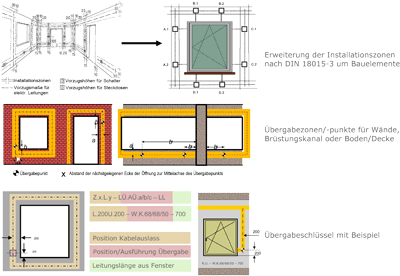
Bild 7 – Planungshilfen für mechatronische Bauteile aus ift-Richtlinie EL-01/1 (Bild vergrößern)
Glasfassaden brauchen Sonnenschutz
Der bisher ungebrochene Trend zur Glasarchitektur hat mit der Diskussion um behagliche Temperaturen im Sommer (siehe auch Beiträge „Gerichtsurteil: 26 Grad im Büro sind genug“ sowie „der Humidex definiert die ‚gefühlte Temperatur‚„), hitzefreie Tage in Schulen und mit der Kritik des Bundesrechnungshofs Zweifel an großflächigen Glasfassaden aufkommen lassen, beispielsweise Beeinträchtigungen der Arbeitsbedingungen durch hohe sommerliche Temperaturen und zu starke Blendung (siehe dazu auch Beitrag „Stoppt Klimadiskussion den Vormarsch der Glasfassade?“ vom 8.6.2007).
Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass viele Mängel auf einer unzweckmäßigen Nutzung des Sonnenschutzes beruhen und die Planungsgrundlagen der EnEV, der DIN V 18599 und DIN 4108-2 nicht beachtet wurden. Sonnenschutzverglasungen sind zwar leistungsfähig, konstruktiv einfach zu integrieren und relativ kostengünstig, schaffen es aber oft nicht, im Sommer die Erwärmung der Innenräume ausreichend zu begrenzen. Deshalb sind zusätzliche Verschattungen notwendig und sinnvoll. Ein Schwachpunkt außenliegender Verschattungen war bislang die Anfälligkeit gegenüber höheren Windgeschwindigkeiten, doch moderne Konstruktionen halten Windstärken bis zu 11 Beaufort stand. Verbundfenster und Zweite-Haut-Fassaden ermöglichen die Integration von Verschattung und Lüftung in einem witterungsgeschützten Bereich, verursachen aber einen konstruktiven Mehraufwand. Eine Alternative sind Sonnenschutzeinrichtungen im Scheibenzwischenraum, die in übliche Fenster- und Fassadenkonstruktionen integriert werden können. Neben der Verschattung muss aber auch eine ausreichende Beleuchtung mit Tageslicht und Blendschutz beachtet werden. Dies ist ideal mit winkelselektiven Sonnenschutzelementen realisierbar, die physikalische Gesetze wie Lichtbrechung (Prismen) oder Reflexion (Spiegelreflektor) nutzen (siehe zudem Beitrag „Broschüre und Studie: Energie sparen mit Sonnenschutz“ vom 27.7.2009).
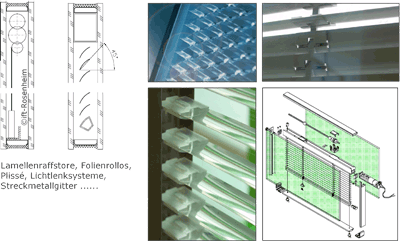
Bild 8 – Sonnenschutz im Scheibenzwischenraum (Bild vergrößern)
Fenster und Fassaden als Energieerzeuger
Die verfügbare Sonnenenergie ist 3000-mal höher als der weltweite Energiebedarf. Es liegt nahe, sie mit Fenstern, Fassaden und Verglasungen zu nutzen. Um die energetische Leistungsfähigkeit (solarer Nutzungsgrad) von Gläsern und Fenstern zu bewerten, muss neben dem U-Wert auch der Gesamtenergiedurchlassgrad g der Verglasung beachtet werden. Deshalb wird der g-Wert der Gläser durch neue Beschichtungen kontinuierlich verbessert und erreicht heute bei Dreifachgläsern 0,6 bei einem U-Wert von 0,7 W/(m²K).
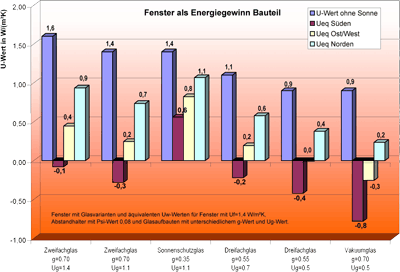
Bild 9 – Energiegewinnung mit Fenstern (Bild vergrößern)
„Sonnen-, Energiegewinn- oder Energieplushäuser“ nutzen die solaren Einstrahlungen durch gesteuerte Verschattung oder thermische Pufferspeicher und sind eine folgerichtige Weiterentwicklung des Passivhauses. Die Strahlungsenergie der Sonne kann zusätzlich mit Solar-/Photothermie und Photovoltaik in der Gebäudehülle genutzt werden (siehe zudem Beitrag „Gebäude – ästhetischer Energiesammler statt dröge Energieschleuder“ vom 31.7.2007).
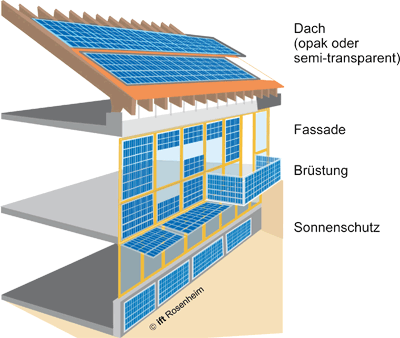
Bild 10 – Sinnvolle konstruktive Integration von Photovoltaikelementen in die Gebäudehülle
Bislang werden solche Bauelemente oft noch „additiv“ eingesetzt. Sinnvoller ist es, diese mit Doppelfunktionen zu konstruieren, indem PV-Elemente direkt als Dach oder Fassadenbekleidung nutzbar sind. Eine Revolution wird mit der breiten Markteinführung von Dünnschicht-PV-Elementen erwartet, die nur unwesentlich teurer als übliche Fassadenverkleidungen sein werden und aufgrund ihrer Wirkweise gute Energieerträge, auch bei diffusem Licht und auf der „Schattenseite“ der Gebäude, bringen (siehe z.B. auch Beitrag „Photovoltaik-Fassade „ARTLine Invisible“ mit farbigen CIS-Modulen“ vom 8.6.2009).
Bauelemente trotzen Naturkatastrophen
Jenseits von Energieeinsparung und CO2-Reduktion gewinnt auch der Schutz vor Hochwasser und Sturm an Bedeutung. Bis zum Jahr 2050 sollen die sommerlichen Temperaturen in Deutschland um 2°C bis 5°C steigen, mit der Folge häufiger Hitzewellen, Unwetter, Stürme und Sturmfluten. Eigentümer und Bewohner von Gebäuden suchen deshalb nach geeigneten Schutzmaßnahmen. Auch die Versicherungswirtschaft reagiert auf diesen Trend mit höhere Prämien für gefährdete Gebiete. Hochwasserbeständige Fenster und Türen, die nach der ift-Richtlinie „FE-07/1 Hochwasserbeständige Fenster und Türen“ geprüft wurden, schützen Gebäude vor Hochwasser, was die Versicherungen mit niedrigeren Beiträgen belohnt.
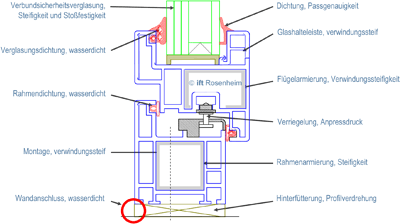
Bild 11 – Konstruktionsmerkmale für hochwasserbeständige Fenster aus ift-Richtlinie FE-07/1 (Bild vergrößern)
Fazit – Nachhaltig Bauen
Die intensive Diskussion über Nachhaltigkeit lenkt die Aufmerksamkeit auch auf den hohen Energie- und Ressourcenverbrauch von Gebäuden. Neue innovative Techniken werden oft im Nichtwohnungs- und Industriebau eingesetzt. Im Forschungsprojekt „Energieoptimiertes Bauen – EnOB“ (siehe Beitrag „BINE-Broschüre dokumentiert EnOB“ vom 9.8.2009), wurden 2008 deshalb innovative Fassaden- und Gebäudekonzepte von Nichtwohngebäuden im Praxiseinsatz analysiert, bei dem folgende interessante Ergebnisse ermittelt wurden:
- Der Unterschied zwischen angegebenem und tatsächlichem Energieverbrauch ist teilweise extrem hoch.
- Der Stromverbrauch beträgt bis zu 70 % des Gesamtenergieverbrauchs. Effiziente Beleuchtungssysteme können erfolgreich zur Stromreduzierung eingesetzt werden.
- Der Anteil für die Kühlung beträgt häufig weniger als 10 % des Primärenergieverbrauchs.
- Lüftungsanlagen werden effizient geplant, aber ineffizient betrieben.
Dies bedeutet, dass eine ganzheitliche Analyse und eine ständige Optimierung der Fassaden- und Gebäudetechnik sowie die Reduzierung von Kunstlicht die größten Verbesserungen bringen. Innovative Fenster und Fassaden können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.
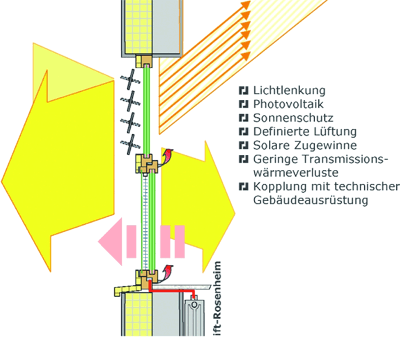
Bild – 12 Merkmale eines modernen Energiegewinnfensters (Bild vergrößern)
Der Autor dieses Fachbeitrages, Jürgen Benitz-Wildenburg,
…leitet im ift Rosenheim die Abteilung PR & Kommunikation. Er ist gelernter Schreiner, Holzbauingenieur, Marketingexperte und seit vielen Jahren in der Holz- und Fensterbranche tätig.
Das ift Rosenheim existiert seit 1966. Es begleitet als neutrale Einrichtung die Fenster-, Fassaden- und Türenbranche in allen Fragen der Forschung, Normung, Zertifizierung und Zulassung. Die ift-Richtlinien sind technische Regelwerke, die Normen ergänzen und deren praktische Anwendung erleichtern. Die Basis dafür sind Erkenntnisse und Erfahrungen aus Industrie, Wissenschaft, Forschung, Prüfungen und Gutachten.
Seit März 2009 bietet das ift zusammen mit der Hochschule Rosenheim den berufsbegleitenden Masterstudiengang „Fenster und Fassade“ an – siehe: www.edpro-rosenheim.de.