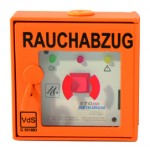Warum natürliche Entrauchung?
Warum natürliche Entrauchung?
Da Brände in Gebäuden grundsätzlich nicht verhindert werden können, erhalten Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) eine zentrale Bedeutung innerhalb des vorbeugenden Brandschutzes.
Im Brandfall geht die Bedrohung nicht nur von Feuer und Hitze, sondern besonders von dem entstehenden Rauch und den giftigen Brandgasen aus. Der bauliche Brandschutz ist zwar so weit entwickelt, dass in einem brennenden Gebäude in der bei uns üblichen massiven Bausubstanz kaum noch Personen direkt durch Feuer verletzt oder getötet werden – wohl aber durch den extrem toxischen Brandrauch. Rauch und Brandgase, die die Bausubstanz angreifen, Rettungs- und Löschwege blockieren, das Feuer in andere, nicht brennende Teile des Gebäudes übertragen können, sind zu fast 90% die Ursache für „Brandopfer“. Brandopfer sind Rauchopfer! Denn das Inhalieren von nur einer Lungenfüllung heißen Brandrauchs kann den sicheren Tod bedeuten. Die wichtigste Aufgabe des vorbeugenden Brandschutzes besteht daher darin Flucht- und Rettungswege rauchfrei zu halten. Personen in brennenden Gebäuden muss ermöglicht werden, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Rettungsmannschaften müssen Menschen, Tiere und Sachwerte retten sowie Brandfolgeschäden vermindern können.
Es ist also besonders wichtig, dass der sich in sehr kurzer Zeit in enormen Mengen bildende Rauch – auch schon bei kleinen Schadensfeuern – schnell und gezielt abgeführt wird.
Der Gefahr der bei einem Brand entstehenden Verbrennungsprodukte wie Rauchgas, Oxide und Wärmeenergie begegnet man am besten durch eine Abführung des Rauches ins Freie. Diese wichtige Aufgabe übernehmen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Diese führen den Rauch effektiv aus dem Gebäude ab. Räume und Gebäude ohne RWA werden in wenigen Minuten vollständig mit Rauchgasen ausgefüllt. Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen sind somit zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Brandschutzkonzepten geworden.
 Wie funktioniert Rauchabführung eigentlich
Wie funktioniert Rauchabführung eigentlich
Die natürliche Entrauchung nutzt den thermischen Auftrieb – mit Zuluftöffnungen im unteren Wandbereich und Abluftöffnungen möglichst im oberen Wand- oder Deckenbereich – um den Rauch in einer stabilen Rauchschichtgrenze oberhalb des Aufenthaltsbereiches des Menschen zu binden. Unter dieser Grenze befindet sich die raucharme, darüber die schwarze, giftige Rauchgasschicht. Wichtig bei dieser Methode der Rauchabführung ist, dass es an der Rauchschichtgrenze nicht zu einer Verwirbelung kommt, denn das könnte zu einer Absenkung der giftigen Rauchschicht in den raucharmen Bereich führen.
Die bei einem Brand entstehenden Verbrennungsprodukte wie Rauch, Wärme und heiße Brandgase steigen im Raum nach oben und bilden unterhalb der Decke eine Schicht aus Rauch und Brandgasen. Diese Rauchgasschicht wird mit fortschreitender Branddauer immer dichter und innerhalb kürzester Zeit ist der gesamte Raum ausgefüllt. Mit Hilfe der natürlichen Rauchabzugsanlage (NRA) wird diese Schicht mittels des thermischen Auftriebsprinzips bereits in der Entstehungsphase des Brandes direkt ins Freie abtransportiert. Die notwendigen Zuluftöffnungen sorgen für den erforderlichen Ausgleich des Massenstroms und verstärken den Effekt des thermischen Auftriebs (Kamin-Effekt). Die entsprechenden Rauchabzugsgeräte müssen allerdings gegen äußere Windeinflüsse ausreichend geschützt sein. Denn die Ausbreitung und Ableitung von Rauchgasen hängt – insbesondere bei Bränden in großen Räumen – wesentlich von der Raumströmung ab. Diese wird wiederum von der äußeren Winddruckverteilung beeinflusst. Da sich diese Öffnungen immer an der Wind abgewandten Seite befinden sollten, ist der Einbau von NRA- und Zuluftflächen in mindestens zwei gegenüberliegenden Gebäudewänden erforderlich. Ausführlich beschreibt die DIN 18232 Teil 2 die Anforderungen und Bemessungen an Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.
Der Vorteil der NRA liegt darin, dass sie bei zunehmenden Temperaturen durch höhere Abzugsleistung die zusätzlich entstehenden Rauchgasvolumen abtransportieren kann. Bei der maschinellen Rauchabzugsanlage (MRA) werden die Rauchgase mechanisch über Ventilatoren bei einem konstanten Fördervolumen abgeleitet. Dieses Verfahren ist gut geeignet für niedrige Brandtemperaturen. Bei höheren Temperaturen dagegen kann es vorkommen, dass das konstante Fördervolumen der Ventilatoren die durch die Temperatur wachsenden Volumenströme nicht ausreichend abführen kann
Lichtkuppeln, Lichtbänder, Glaspyramiden, Kipp- oder Klappflügel
Je nach Gebäudeart und Architektur sind verschiedene Formen des Einbaus von RWA-Öffnungen möglich. Bei Flachdachbauten können RWA-Öffnungen in Form von Lichtkuppeln, Lichtbändern oder Glaspyramiden ausgeführt werden. Im geneigten Dach oder Sheddach ist der Einbau als Kipp- oder Klappflügel möglich. Am häufigsten werden RWA-Öffnungen mit den unterschiedlichsten Flügelformen in die Außenwand eingebaut. Um die optimale Wirkung der natürlichen Entrauchung zu gewährleisten, müssen Größe, Art und Anordnung des Öffnungselements beachtet werden.
Wichtig ist, dass die Rauchgase möglichst ungehindert aus dem Gebäude ins Freie ausströmen können, weder der Fensterflügel selbst, noch bauliche Gegebenheiten – wie Mauervorsprünge, Treppen, Lüftungskanäle etc. – dürfen das Ausströmen behindern
Komponenten eines Rauchabzuges
Zum Öffnen und Schließen von RWA-Öffnungen benötigt man einen RWA-Sicherheitsantrieb. Man kann dafür elektromotorische 24V-Antriebe wie z.B. Spindelantriebe, Kettenantriebe und Zahnstangenantriebe verwenden. Die Auswahl ist objektabhängig. Die RWA-Zentrale ist die Steuereinheit für die RWA-Antriebe. Sie nimmt die Meldung der Brandmelder auf, überwacht Störungen und steuert die Lüftungsfunktion. Integrierte Notstrombatterien sorgen bei Netzausfall für eine 72 Stunden währende Betriebsbereitschaft. Manuelle Brandmelder dienen zur Meldung einer durch Hand erfolgten RWA-Auslösung. Die Zustände „Betriebsbereitschaft“, „RWA-Auslösung“ und „Störung“ werden über Leuchtanzeigen signalisiert. Automatische Brandmelder erkennen einen Brand selbständig. Ein Windmessgerät, das die Windgeschwindigkeit und Windrichtung aufnimmt, gewährleistet, dass bei der Entrauchung nur die windabgewandten Flächen öffnen. Die Auswertung der Messwerte übernimmt die angeschlossene RWA-Zentrale. Da sich die 24V-RWA-Sicherheitsantriebe auch für Lüftungszwecke eignen, können die Antriebe mit Lüftungstastern zur manuellen Lüftung verwendet werden.
Hinweise zur Verwendung der DIN EN 12 101 Teil 2
Nachdem im Jahr 2005 die Koexistenzphase der EN 12 101 Teil 2 und der DIN 18 232 Teil 3 noch einmal um ein Jahr verlängert wurde, gilt nun europaweit seit September 2006 einzig die EN 12 101 Teil 2 als Prüfgrundlage für natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG). Seit September 2006 muss in Deutschland für alle bauordnungsrechtlich geforderte Rauchabzugsablagen ein Verwendbarkeitsnachweis nach DIN EN 12 101 Teil 2 vorliegen.
Kann dieser Verwendbarkeitsnachweis nicht erbracht werden, z. B. bei objektspezifischen Sonderkonstruktionen, so gibt es die Möglichkeit bei der obersten Baubehörde der Länder eine Zustimmung im Einzelfall zu beantragen. Dieses Verfahren wird genauer in der Broschüre RWA aktuell Nr. 6 „Individuelle Gebäudeentrauchung und die Zustimmung im Einzelfall (ZiE)“ beschrieben.
Muss zwingend ein NRWG eingesetzt werden
Die Norm EN 12101 Teil 2 generiert ein neues Bauprodukt für den gesamten europäischen Wirtschaftsraum – das NRWG. Ein NRWG muss in Deutschland immer dann eingesetzt werden, wenn ein natürlicher Rauchabzug bauordnungsrechtlich gefordert wird. Diese Anforderung wird vor allem in den Bauverordnung für Sonderbauten wie z. B. Schulen, Verkaufsstätten, Krankenhäuser etc. gestellt.
Wird eine allgemeine Forderung nach einer Rauchableitung so konkretisiert, dass zur Rauchableitung ausschließlich eine bestimmte geometrische Öffnungsfläche (Entrauchungsöffnungen nach der Landesbauordnung z. B. in Treppenhäusern) zur Verfügung stehen muss, bedingt dies nach Auffassung der Fachkommission Bauaufsicht nicht zwingend den Einsatz eines NRWGs. Die Oberste Baubehörde hat mit einem Schreiben an den FK RWA im ZVEI somit klar gemacht, dass sie nicht zwingend NRWGs nach DIN EN 12101-2 als Komponenten einer Rauchableitungsanlage verlangt.
Was ist jedoch zu beachten, wenn eine Rauchabzugsanlage mit einem NRWG gemäß 12 101 Teil 2 ausgeschrieben ist und keine objektspezifische Sonderkonstruktion vorliegt? Für die Bemessung und den Einbau von natürlichen Rauchabzugsanlagen gilt nach wie vor die nationale Norm DIN 18 232 Teil 2. Anhand dieser Norm kann ermittelt werden, wo und in welcher Menge Rauchabzugsflächen bzw. Zuluftflächen mit welchen wirksamen Flächen im Dach bzw. in der Fassade vorzusehen sind. Die aerodynamische Wirksamkeit der Rauchabzugsfläche eines NRWG ist nach dem in der DIN EN 12 101 Teil 2 beschriebenen Verfahren nachzuweisen.
Weiterhin ist zu beachten, das es sich bei der DIN EN 12 101 Teil 2 um eine reine Prüfnorm handelt und die Ergebnisse der unterschiedlichen Prüfungen für ein NRWG in Klassen eingeteilt sind. Nach welchen Vorgaben geprüft wird, z. B. für welche Wind- und Schneelastklassifizierung das Produkt später zugelassen werden soll, gibt der Hersteller des NRWG´s vor. Der Fachplaner oder Architekt ist verantwortlich dafür, dass in seinen Ausschreibungen die Klassen des NRWGs so gewählt werden, dass dieses den Ansprüchen des Bauvorhabens entspricht.
Tipps zur Projektierung des NRWG
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die regional unterschiedlichen Windlasten (Klassifizierung WL) in der DIN 1055-4: 2005-03 und die Schneelast (Klassifizierung SL) in der DIN 1055-5: 2005-07 geregelt. Bei der Wärmebeständigkeit ist in der Regel von der Klassifizierung B300 auszugehen. Dieses entspricht einer Temperaturbeständigkeit des gesamten NRWG´s von 300°C über einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten. Bei der Klassifizierung für niedrige Temperaturen ist der Einsatzfall des NRWG´s (z. B. im offenen oder im geheizten Gebäude) zu berücksichtigen. Bei der Klassifizierung der Funktionssicherheit (Klassifizierung Re), muss betrachtet werden, ob die NRWG´s ausschließlich für den Rauchabzug oder auch zur täglichen Be- und Entlüftung verwendet werden. Geräte, die für die tägliche Be- und Entlüftung verwendet werden, sind – neben der je nach Klasse notwendigen Prüfung der Funktionssicherheit – zusätzlich 10.000 mal in Lüftungsstellung zu öffnen.
Einbau von RWA und Lüftungs-Systemkomponenten
Die Ab- und Zuluftöffnungen müssen so bemessen sein, dass im geöffneten Zustand die geforderte geometrische bzw. aerodynamische Fläche erreicht wird. Zu beachten sind hierbei Behinderungen, wie z. B. Blendrahmen und Stürze.
Die Zuleitungen einer RWA Anlage müssen den Brandschutzbestimmungen (z.B. MLAR) entsprechen und vom Querschnitt den benötigten Motorströmen bzw. Volumen angepasst sein. Die elektrische RWA-Zentrale sollte in einen dafür vorgesehenen Technikraum eingebaut werden. Um eine sofortige Auslösung bei einem Brand in diesen Räumen zu gewährleisten, sind hier automatische Brandmelder empfehlenswert. Manuelle Brandmelder müssen gut sichtbar sein und sollten an zentralen Stellen wie an Eingangs- oder Empfangsbereichen montiert werden. Es ist sinnvoll, den Einbauort mit einem Schild „Rauchabzug“ zu kennzeichnen. Automatische Brandmelder sind so zu platzieren, dass das Auslösekriterium, wie z. B. Rauch oder Hitze, den Melder erreichen kann. Um Fehlauslösungen zu vermeiden, muss bekannt sein, welche Gegebenheiten in dem entsprechenden Gebäudeteil im Normalbetrieb herrschen. Hierzu gehören u. a. Staub, Wasserdampf oder auch höhere Temperaturen unter Glasflächen. Abstände zu Wandflächen sowie die Überwachungsfläche der Melder sind bei der Planung und beim Einbau zu beachten.
RWA-Anlagen sind im Hinblick auf die Rettung von Menschenleben und Materialien eine zwingende Notwendigkeit. Nur die Installation einer RWA-Anlage kann die Gefahr durch Rauch- und Brandgase bannen. Nicht ohne Grund ist die Forderung nach einer RWA-Anlage Bestandteil jeder Bauordnung der Bundesrepublik Deutschland. Zuletzt ist nicht zu vergessen, dass jede elektromotorische RWA-Anlage automatisch den Zusatznutzen der täglichen Lüftung bietet. Die im ZVEI Fachkreis Sicherheit organisierten Firmen und deren Facherrichter sind Ihnen gerne jederzeit bei der Auslegung und Errichtung einer für Ihr Bauvorhaben individuell angepassten Rauch- und Wärmeabzugsanlage behilflich. Eine Herstellerübersicht ist erhältlich über den ZVEI.
Text: ZVEI FK Rauchabzug
Bilder: ZVEI

 Warum natürliche Entrauchung?
Warum natürliche Entrauchung? Wie funktioniert Rauchabführung eigentlich
Wie funktioniert Rauchabführung eigentlich Seit mehr als 25 Jahren im Dienst der Sicherheit
Seit mehr als 25 Jahren im Dienst der Sicherheit
 Eine schnelle und geordnete Evakuierung stellt hohe Anforderungen an Planer, Errichter und Betreiber eines Gebäudes. Das gilt insbesondere für komplexe Objekte, die für eine große Zahl ortsunkundiger Besucher ausgelegt sind. Alle Personen im Gebäude verlassen sich im Gefahrenfall darauf, unverletzt und ungefährdet in sichere Bereiche geleitet zu werden.
Eine schnelle und geordnete Evakuierung stellt hohe Anforderungen an Planer, Errichter und Betreiber eines Gebäudes. Das gilt insbesondere für komplexe Objekte, die für eine große Zahl ortsunkundiger Besucher ausgelegt sind. Alle Personen im Gebäude verlassen sich im Gefahrenfall darauf, unverletzt und ungefährdet in sichere Bereiche geleitet zu werden.